Unterschied mündliches und schriftliches Erzählen
Hier erhältst du einen Überblick über mündliches und schriftliches Erzählen in folgenden Punkten:
Erzählzeit, Erzählort, Adressatenbezug, Sprache, Stil und Satzbau.
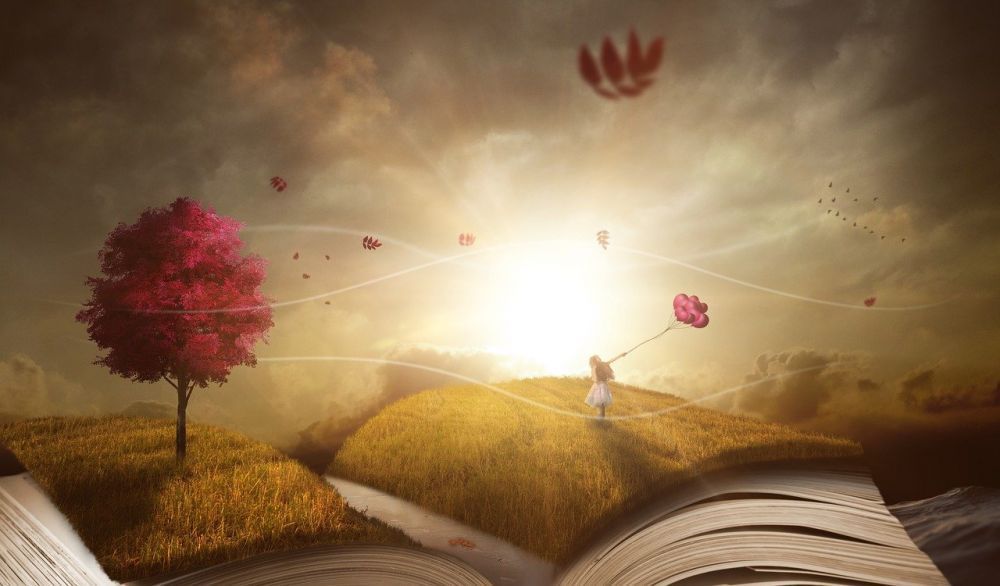
Erzählzeit:
a) mündliches Erzählen:
Beim mündlichen Erzählen ist die Zeitform “Perfekt” die bevorzugte Erzählzeit.
Bildung: Hilfsverb sein/haben + Vollverb im Partizip 2
Beispiele: ich habe gegessen, du bist gewesen, er hat gesehen, …
Satz: Gestern bin ich nach Dornbirn gefahren.
b) schriftliches Erzählen:
Beim schriftlichen Erzählen ist die Zeitform “Präteritum” die bevorzugte Erzählzeit.
Bildung: 2. Stammform
Beispiele: ich aß, du warst, er sah,…
Satz: Gestern fuhr ich nach Dornbirn.
Erzählort/Anwendung:
a) mündliches Erzählen:
Das mündliche Erzählen verwenden wir in unserem Alltag, wenn wir mit einer persönlich anwesenden Person bzw. Personen, oder einer virtuell anwesenden Person bzw. Personen kommunizieren.
Die Regeln sind aus dem jeweiligen Kontext des Gesprächs definiert.
In diese Erzählungen fließen Berichte, Beschreibungen und unsere persönliche Meinung mit ein.
b) schriftliches Erzählen:
Das schriftliche Erzählen erfolgt in Form von Aufsätzen (Schule) oder in Form von Geschichten, Büchern.
Die Regeln sind hier klar aufgrund der jeweiligen Aufgabenstellung definiert.
Adressatenbezug:
a) mündliches Erzählen:
Diese Person oder Personen können Familienmitglieder, Freunde, Bekannte oder Zufallsbekanntschaften sein.
Auf jeden Fall handelt es sich um eine Person bzw. Personen, die wir im Gespräch persönlich adressieren.
Da ein persönlicher Bezug und Augenkontakt besteht spielt neben der verbalen auch die nonverbale Kommunikation eine große Rolle.
Eigene Gefühle, Stimmungen und Zielsetzungen sind bei dieser Art des Erzählens wesentlich.
Nicht zuletzt in welcher Beziehung ich zu dieser Person stehe und über welches gemeinsame Erinnerungsfeld ich mit dieser Person teile.
b) schriftliches Erzählen:
Hier ist kein persönlicher Adressat erkennbar, ich erzähle etwas, was ein mir unbekannter Leser für sich interpretieren wird.
Nur das geschriebene Wort ist hier die Brücke zwischen Schreiber und Leser.
Dies führt dazu, dass Leser die Erzählung aufgrund ihrer Lebensbiograph unterschiedlich interpretieren können.
Sprache:
a) mündliches Erzählen:
Mündliches Erzählen wird vorzugsweise in einer umgangssprachlichen Form geführt.
Beispiel: “Du glaubst es nicht, Alter, was mir gestern Cringes geschehen ist.
b) schriftliches Erzählen:
Beim schriftlichen Erzählen verwenden wir hingegen die Standardsprache, weil Abweichungen aufgrund von Formvorgaben sanktioniert werden.
Beispiel: Gestern am Abend geschah etwas Seltsames.
Stil:
a) mündliches Erzählen:
Beim mündlichen Erzählen dominiert der Nominalstil.
Das heißt in unseren mündlichen Erzählungen verwenden wir überdurchschnittlich viele Nomen und Nominalisierungen.
Beispiel: Lernen ist gut gegangen, Schwierigkeiten habe ich keine gehabt, alles ist nach Plan gelaufen.
b) schriftliches Erzählen:
Beim schriftlichen Erzählen hingegen dominiert der Verbalstil.
Das heißt in unseren schriftlichen Erzählungen verwenden wir überdurchschnittlich viele Verben und Adjektive.
Beispiele: Ich lernte fleißig, machte wenig falsch und alles lief planmäßig.
Satzbau:
a) mündliches Erzählen:
Hinsichtlich des Satzbaus verwenden wir beim mündlichen Erzählen hauptsächlich Hauptsatzreihen.
Hauptsatzreihen bestehen mindestens aus zwei Hauptsätzen.
Hauptsätze (HS) erkennt man daran, dass sie alleine stehen können und dass das Prädikat an zweiter Stelle steht.
Zudem kann man Hauptsatzreihen an den Konjunktionen erkennen: und, aber, denn, …
Beispiel: Ich bin gestern bei Mira gewesen (HS) und habe dort auch ihren Bruder gesehen (HS).
b) schriftliches Erzählen:
Beim schriftlichen Erzählen werden hingegen oft Satzgefüge verwendet.
Satzgefüge bestehen mindestens aus einem Hauptsatz (HS) und einem Gliedsatz (GS).
Gliedsätze erkennt man daran, dass sie nicht alleine stehen können und das Prädikat an letzter Stelle steht.
Zudem gib es Subjunktionen mit denen man Satzgefüge erkennen kann: dass, das, da, …
Beispiel: Als ich gestern bei Mira gewesen habe (GS), habe ich dort auch ihren Bruder getroffen (HS).
